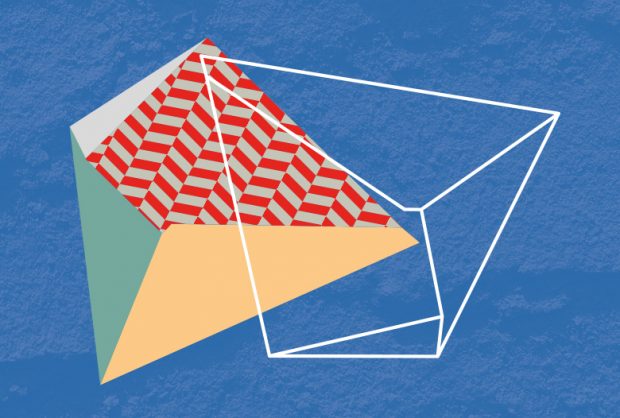Neulich überforderte mich alles. Im Studium steht die Abschlussarbeit vor der Tür. Meine WG sieht schrecklich aus. Und dann ist da noch dieser Nebenjob, der so anstrengend ist, weil er von mir fordert, mich immer wieder in neue Gefilde zu begeben. Ich frage mich eigentlich nur noch: Wo ist meine Grenze?
Aus meiner Perspektive können mich Grenzen beschützen, Dinge zu tun, die mir zu anstrengend, moralisch unpassend, nicht angebracht oder vielleicht nicht sozial akzeptiert erscheinen. Daher empfinde ich Grenzen als orientierungsgebend und manchmal auch entlastend. Grenzen haben allerdings oft ein negatives Image wie beispielsweise Grenzen im politischen Sinne.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann ist der Meinung, dass wir ohne Grenzen nicht leben könnten. Wer als Mensch wissen will, wer man eigentlich ist, müsse verstehen, wie man sich von anderen unterscheidet. Der Mensch sei ein soziales Wesen und Grenzen seien nichts anderes als eine symbolische Markierung dafür, dass wir uns voneinander sichtbar abgrenzen. Dies könne man auch in untereinander geteilten Ansichten, Formen des Humors oder in Wertvorstellungen erkennen. Manch einer meiner Bekannten fühlt sich von starren Grenzen schnell eingeengt und somit in seiner Freiheit eingeschränkt. Bis zu einem gewissen Grad sind Grenzen allerdings eine Bedingung von Freiheit. Liessmann beschreibt dies anhand des menschlichen Strebens nach Freiheit, welches nur denkbar durch das Überwinden bestehender Grenzen ist. Ohne sie wäre jedes menschliche Handeln vollkommen orientierungs- und richtungslos, zufällig und beliebig.
Die Freiheit der Grenze vs. grenzenloser Überforderung
Klare Grenzen helfen mir Entscheidungen zu fällen. „Will ich – oder will ich nicht?“: Die Psychologin Maja Storch befasst sich mit der Frage, wie man herausfinden kann, was man wirklich möchte. Sie beschreibt zwei Bewertungssysteme, mithilfe derer ein Mensch entscheiden kann. Zum einen mit dem Verstand, welcher präzise, nachvollziehbar, bewusst und langsam arbeitet. Und das Bauchgefühl, welches unbewusst, oft diffus und sehr schnell arbeitet. Ideal ist es, wenn beide Systeme miteinander kooperieren. Somit kann uns der Körper beispielsweise Signale durch ein Ziehen im Bauch senden, wenn uns etwas nicht zusagt und ein warmes Gefühl wiederum zeigt, dass uns etwas gefällt. Solche Signale nennt man in der Neurobiologie „somatische Marker“.
Die Qual der Wahl
In manchen Entscheidungssituationen lässt man sich von anderen für etwas trotz eines unguten Gefühls breitschlagen. Solche Warnrufe sollten in der Regel ernstgenommen werden. Denn somatische Marker können uns helfen, eine kluge und für uns passende Entscheidung zu treffen. Natürlich gibt es auch Situationen wie beispielsweise ein aufreibender Zahnarztbesuch, bei denen uns somatische Marker nicht helfen können, da man den langfristigen Plan verfolgt, seine Zähne gesund zu halten.
So viel Grenze wie nötig, so viel Freiheit wie möglich
Insgesamt sind Grenzen weder gut noch böse. Eine Grenze kann einen Menschen schützen oder herausfordern. „Gute“ Grenzen machen das Leben leichter, denn sie fördern Distanz und Respekt, können aber auch Nähe zulassen. Dennoch gibt es viele Grenzen, die Menschen willkürlich trennen oder Menschen in ihrem Sein behindern. Im Zusammenhang mit meinen eigenen Grenzen empfinde ich das Erkunden und Bewusstmachen des eigenen Wollens als sehr wichtig, denn dies kann mir helfen, Grenzen zu setzen und diese einzuhalten.
Neue Psychologie-Kolumne im P
Unsere Autorin Lea Sahm studiert Psychologie in Darmstadt, war als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin tätig und hat dabei unter anderem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Im P schreibt sie über Gefühle, mentale Gesundheit sowie den Zusammenhang von Leib und Seele.